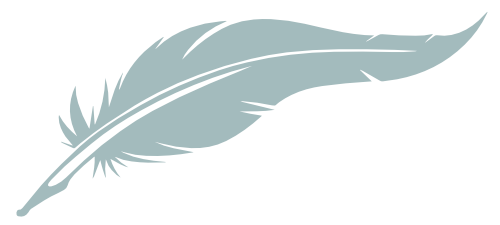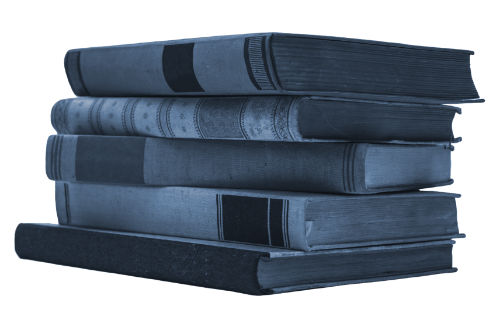Das Projekt – Die verlorenen Worte
Wir – die Wortfinderinnen – haben es uns zur Aufgabe gemacht, die vergessenen und verlorenen Worte der deutschen Völker ans Licht zu holen und unsere schöne deutsche Sprache wieder auf allen Ebenen damit zu bereichern. Es geht uns dabei um einen bewußten Sprachgebrauch und das Aufspüren verdrehter, falscher oder eingeschränkter Begrifflichkeiten.
Zu diesem Behufe haben wir weitere Themenbereiche eingeführt:
- Verdrehte Worte, deren Bedeutung umgekehrt, eingeschränkt oder anderweitig verändert wurde. Im Zuge unserer bisherigen Nachforschungen treten diese Spiegelungen und Verdrehungen immer deutlicher zutage – der gesamte Wortschatz wurde und wird weiterhin stetig verfälscht. Sorgen wir für Klarheit, Reinheit und Vielschichtigkeit im täglichen Gebrauch der deutschen Sprache durch einen bewussten Umgang mit ihr und ihren Ausdrucksmöglichkeiten.
- Lehnworte/Fremdworte, um über deren wahre Bedeutung aufzuklären und an ihrer Stelle deutsche Worte mit ihrer umfassenden Begrifflichkeit anzuwenden, statt sie aus dem Lateinischen oder anderen Sprachen zu entlehnen.
- Herzöffnende Worte, die uns Menschen auf der Herzensebene verbinden.
- Denglische Worte und englischsprachige Ausdrücke, die eigens für den Gebrauch im Deutschen künstlich geschaffen wurden oder aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum mittlerweile für nahezu jeden Lebensbereich unmittelbar übernommen worden sind. Wir möchten dafür deutsche Begrifflichkeiten ausfindig machen, um die denglischen Worte ihrer Überflüssigkeit zu überführen.
Und dazu brauchen wir Deine Unterstützung: Stöbere in Bibliotheken, im Keller oder auf dem Dachboden in alten Büchern nach Dir unbekannten Worten – werde auch Du ein Wortfinder!
Wir sind eine kleine Gruppe von Frauen aus allen Teilen Deutschlands, welche die Leidenschaft für die Schönheit der deutschen Sprache vereint. Wir sind Menschen wie DU und ICH und unsere Zusammenarbeit, das Freudetun, wird durch die Liebe zum sprachlichen und kulturellen Erbe gespeist. Das Projekt „Die verlorenen Worte“ wurde von William und Lisa Toel ins Leben gerufen. Mehr über ihr Wirken findest Du auf ihrer Webseite: www.williamtoel.de.
Herzliche Grüße von den Wortfinderinnen